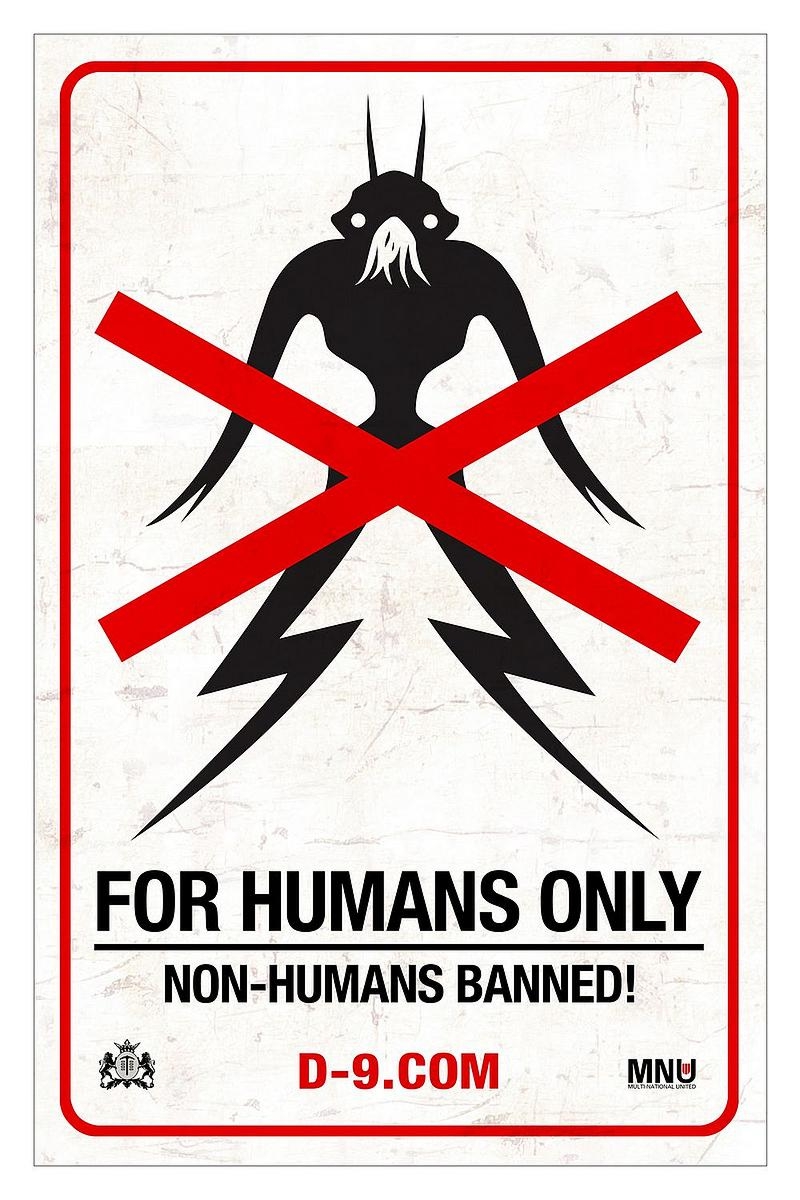Nach der folgenden Passage zwang ich mich noch 20-30 Seiten zu lesen und merkte: hier hat sich ein krampfhaftes Ich ein eigenes Brett vor den Kopf genagelt und wendet höchstenfalls zwei grobe Schablonen auf eine ganze Gesellschaft (und über drei Generationen hin) an.

"Und Juden, die noch da waren, wenige unsichtbare Geschäftsleute, Ärzte und deren Kinder, die jedes Jahr am 9. November kurz im Fernseher erschienen, als kleine, dunkle Menschengruppe vor einer riesigen Menora oder einer dramatischen hoch aufgehängten Schiefertafel mit kaum lesbaren hebräischen Buchstaben. Es regnete und war windig, und sie hielten sich an ihren Regenschirmen fest, und dann wurden sie weggeweht und tauchten erst am 9. November nächsten Jahres auf. Jemand wie ich war in Deutschland nicht vorgesehen. Wenn man mich fragte, was ich bin, sagte ich:"Ich bin Jude." Ich sagte es, weil es so war, und es wunderte mich, dass es die anderen verwirrte. Das merkte ich daran, dass sie sofort das Thema wechselten, gerührt lächelten oder leise erwiderten; "Ach so". Es störte sie nicht, manche interessierte es sogar. Und es war nie ein Hindernis für eine Freundschaft zwischen ihnen und mir, dem Besucher aus einer Zeit, die im Januar 1933 auf Wunsch von 33 Prozent der Deutschen zu Ende gegangen war." (S.12)
Die meisten Menschen, egal welchen Ursprungs, die seinen Intellekt haben, würden auf die Frage, was sie seien (zumindest vermutlich) antworten: Weltbürger, Mensch, Denkender. Hier verfängt sich jemand im Jude-Sein ohne dass er es müsste. Wer glaubt in Deutschland nicht vorgesehen zu sein, hat seinen Ort glaube ich noch nicht gefunden. Dass das auch Deutschen so geht, braucht hier eigentlich nicht angemerkt zu werden. Dass das auch kein exklusiv jüdisches Phänomen ist, haben mindestens Broder und Reich-Ranicki gezeigt.
Der ironisch-unironische Stil (dieser Ausdruck kommt von ihm) dieser Passage, wirkt künstlich und plagiativ.
Biller scheint sogar einige Kurzgeschichte geschrieben zu haben, die in einer ironischen Pointe enden (z.B. diese hier). Ich fürchte, dass diese Ironie auch in seinem Selbstporträt so beißend ist, dass sie die Obergrenze des Witzes bereits überschreitet. Sie ist kaum noch Ironie, ihre kritisches Anliegen liegt so blank, dass sie ihr humoristisches Element verliert. Wer über sich so schreibt, der steht metaphorisch gesprochen mit dem Kopf zur Wand. Es ist ein Anzeichen, dass es ihm nicht gelingt Kraft intellektueller Leistung sich selbst zu therapieren. Biller nutzt allerdings scheinbar sein geistiges Organon um diesen Umstand zumindest auszudrücken. Was dabei entsteht ist leider keine Ironie mehr, sondern entblößt diese krasse Unfähigkeit.
Warum nicht eine offene Kritik an der Gesellschaft schreiben? Mangelt es da an den nötig hard facts?
Die Ironisierung der Reibungen des eigenen Ichs gegen eine Gesellschaft, in der eine solche Situation de jure verboten und faktisch fast unmöglich ist, ist Symptom und Prädikat einer Sache, die man getrost Egomanie nennen darf.
In Billers Fall ist zudem offensichtlich: Wer sucht der findet. Biller suchte Diskriminierung, er fand sie. In einem solchen Fall ist psychoanalytisch fast klar, wer nicht findet, der imaginiert. Vermutlicht liegt es daran, dass es nichts zu findet gibt, dort wo Biller sucht. Ich meine damit, dass ich grundsätzlich ausschließe, dass man in dem Milieu, von dem er redet, offensichtlichen Rassismus findet. Die häufigsten Rassismen auf die man in Deutschland trifft sind gekennzeichnet durch hohle Phraseologie, abgedroschenen Symbolismus und veraltete Kampfbegrifflichkeit (gleiches gilt im übrigen für die dogmatische Linke). Diesen Rassismus braucht man nicht mehr als seriöse politische Alternative aufzufassen. Man darf ihn getrost als substanzlosen Schwachsinn bezeichnen. Wer dem nicht glaubt, hat nur Angst die rechte Intelligenzjia könnte durch versteckte Subtilität wieder zu "alter" Strahlkraft zurückfinden. Ein kurzer Blick hinter die Kulisse einer solchen "Bewegung" entblöst die Protagonisten und zeigt ein niederschmetterndes Bild von Figuren, die keine ernstzunehmenden Gegner im Kampf um die Demokratie sind. Es zeigt sich dass man dort Ressentiments adaptiert hat, deren Feindbilder es garnicht mehr gibt (Seit den enormen Massenbewegungen nach dem 2. Weltkrieg, dürften 90% der Deutschen einen Migrationshintergrund haben). Sich mit diesem Thema länger zu befassen heißt in erster Linie Zeit zu vergeuden und den Blick für wesentlichere postideologische Problemfelder (MultiMedien, Demografie, säkularisierte Wirtschaft, Lobbyismus, Parallelgesellschaften) zu verlieren. Das dürfte Biller passiert sein. Vermutlich weil er kategorisch ausschließt, dass seine Probleme im Kern Ursprung einer zeitaufwendigen Persönlichkeitsstörung sind, der er sich hingebungsvoll widmet.
"Ich bin Jude und nichts als Jude, weil ich wie alle Juden nur an mich selbst glaube..." (S.12), schreibt Biller. Ich bin mir sicher, dass nicht alle Juden nur an sich selbst glauben oder versuchen sich so krass zu distinguieren. Biller ist anders, besonders, weil er besonders sein will, und das ist unabhängig von dem was er ist oder glaubt zu sein: einfach nur ekelhaft nervig.
Wer ein so labiles Feingespür hat wie Maxim Biller, oder anders gesagt, wessen Kritikfähigkeit auf so dünnem Eis angesiedelt ist, der kann nur ins kalte Wasser fallen. Hier täte einem Biller fast Leid, wäre er nicht so unglaublich arrogant.
Anbei leistet der Text zum historischen Verständnis der dt. Nachkriegsmentalität überhaupt keinen Aufschluss.
(Wer genau darauf achtet, nimmt wahr, dass Biller im Video in einen sehr künstlichen nasalen affektierten Tonfall umschwenkt. Diese Geste weist ihn spätestens jetzt als einen Schwergewichtsschattenboxer aus.
Unter dem Video steht bei Youtube.de folgender Kommentar:
Autor: tjb1982
"Worauf will Biller eigentlich hinaus? Wenn keiner seine Texte liest, soll er spannender schreiben. Statt dessen soll die deutsche Kultur schuld sein, die seine Bücher nicht versteht. Ist ein bißchen armselig.")
(Dieser Kommentar ist zu einem großen Teil die Frucht der intensiven Gespräche mit Simon S. und Roman S.. Dank euch beiden =))